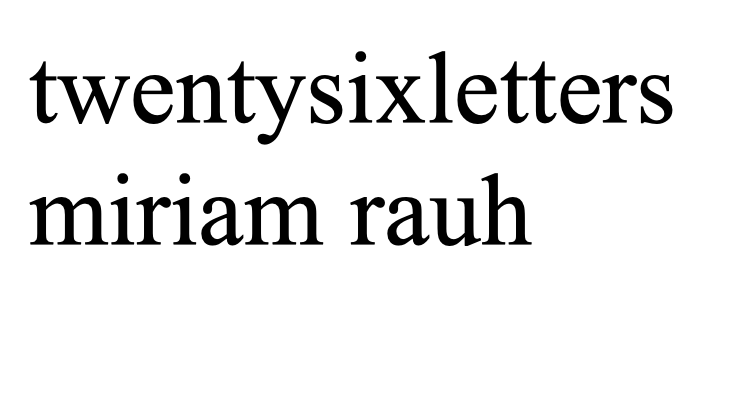Es war kalt. Dicht an dicht saßen wir im Bus. Als wir die Grenze passierten, die es politisch nicht mehr wirklich gab, wohl aber noch physisch in Form von Grenzhäuschen und wortkargen Grenzern mit langen Mänteln und Fellmützen, die unsere Pässe einsammelten und bestimmt eine ganze lange Stunde prüften, bevor wir weiterfahren durften, waren wir still. Wir, die Wagenladung pubertierender, respektloser, naiver Kleinstadtkids, die wir unbedingt dabei sein wollten, in diesen historischen Tagen, und das am Besten mittendrin.

Endlich angekommen, stapften wir ziel- und planlos durch die Gegend. Ich weiß noch, dass ich fürchterlich gefroren habe und, schüchtern wie ich war, nicht wagte, Passanten nach dem Weg zu fragen und dass ich schließlich doch an der Mauer ankam, die mit Hämmern und Meißeln langsam abgetragen wurde. Irgendwo liegt es noch, das kleine Stück Beton, vergraben unter alten Briefen und ersten eigenen Dokumenten. Berlin… Ich war total überfordert, mit dieser großen, wirren Stadt, die sich in einem flirrenden, fiebrigen Ausnahmezustand bewegte und mich seit dieser ersten Begegnung nicht mehr losgelassen hat. Ich wollte unbedingt zurück in dieses Niemandsland, in diesen Raum, der sich mir und allen anderen gerade öffnete, in diese fremde Welt die so seltsam und so vertraut zugleich war. Ich wollte in mein Zirkuskinderland. Ich wollte es so sehr, dass ich sogar davon träumte.
Ein paar Jahre sollte es noch dauern, aber ich kam wieder. Ich werde nie vergessen, wie der Hackesche Markt Anfang der 90er Jahre ausgesehen hat. Ich sehe die Einschusslöcher in den Hausfassaden, die Dunkelheit der Strassen im Prenzlauer Berg, rieche die billigen Kohlen im Winter. Ich erinnere mich daran, dass ich mir fast die Wohnung mit der Gamat-Heizung abgefackelt hätte, weil die Vorhänge zu lang waren, dass ich mich in einer Plastikschüssel in der Küche wusch, weil ein richtiges Bad ein Luxus war, den nicht viele hatten. Ich denke an den Platz an der Mauer-/Ecke Kronenstrasse, gleich hinter dem „Friseur“, auf dem die Reste eines eingefallenen Hauses standen über dessen Kellertreppe man in feuchte, nach Schimmel riechende Kammern stieg, um Caipirinha zu trinken und Trommelmusik zu hören. Ich denke an Autorennen am 17. Juni, die Stadt war leer und ein alter Mercedes immer noch schneller als die Polizeitrabbis aus dem alten Osten. Ich denke an heimliche Bootstouren durch die Kanalisation, an verlassene Wohnungen, in denen das letzte Frühstück noch auf dem Küchentisch stand, wenn man sie als neuer Mieter übernahm. Ich denke an die vielen, vielen Bars und Clubs und temporären Orte, die aus den Hinterhöfen und in Kellern wuchsen und wucherten, ständig neu, immer woanders, man hätte jeden Tag an einem neuen Platz sein können, an jedem Tag in der Woche.
Die ersten Jahre in Berlin habe ich staunend verbracht. Ich habe mich immer wieder gewundert. Berlin in der Nachwendezeit war ein verwunschener Ort. Eine Stadt die gleichermaßen zusammen wollte wie sie auseinanderstrebte. West und Ost waren so spröde wie leidenschaftlich, wie Geliebte, im ewigen Clinch miteinander, mit dir nicht und ohne dich auch nicht. „Ham wa nich“ wurde zu meiner persönlichen Metapher, zu einer Hymne für das Berlin der 90er Jahre, die etwas kokett sowohl den permanenten Mangel wie auch die Poesie des Immer-Alles-Möglichen umschreibt.
Dieser Beitrag wurde auch auf Sounds-Like-Me veröffentlicht.