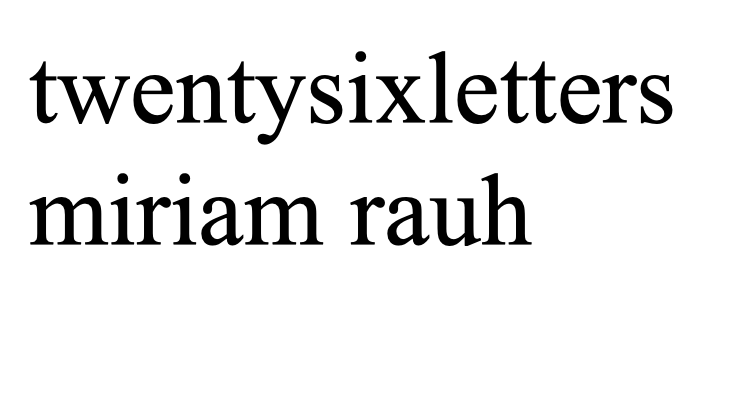Was passiert mit Berlin – bleibt die Stadt an der Spree ein panerotisches Armenhaus oder hat sie eine glanzvollere Zukunft? Wer könnte besser darüber nachdenken als jemand, der Berlin sowohl aus der Perspektive der Sub- als auch der Hochkultur kennt und der darüber hinaus mit einigen Metropolen dieser Welt recht gut vertraut ist.

//Foto: Michael Hoelzl©2013VG-Bildkunst-Bonn//
Nikolaus Jagdfeld ist vielen Berlinern ein Begriff. Als Gründer des legendären Scala Clubs in der Friedrichstrasse und auch als Mit-Geschäftsführer des Berliner Departmentstore Quartier 206, einem in ganz Europa für sein einzigartiges Konzept und Angebot bekannten Kaufhaus der Luxusklasse, hat er sich in kurzer Zeit einen Namen gemacht. Recht neu eröffnet hat er den Departmentstore-Cabinet Store, eine Art Raritätensammlung, die sich wohltuend vom sterilen Design anderer Konzept-Stores abhebt. Mode, Fotografie und Interior-Design verbinden sich im Departmentstore-Cabinet, Kunden finden „eine Vielfalt von Objekten unterschiedlichster Art und Herkunft (die) zu einer neuen Einheit und Weltsicht“ verschmelzen.
In seinem Berliner Büro gibt Nikolaus Jagdfeld zwischen einer eklektischen Mischung ausgewählter schwarz-weiß Fotografien, ethnischer Kunst und abendländischer Designklassiker Einblick in seine Gedanken über die Zukunft des Handels und Berlin und beantwortet dabei auch ein paar persönliche Fragen.

MR_ Ist Berlin nicht nach wie vor eine sehr spröde Stadt, was Luxus anbelangt? Wie ist das mit den Kunden im Department Store? Sind das Leute, die von irgendwoher nach Berlin kommen oder sind es Berliner?
NJ_ Wir haben im Departmentstore Quartier 206 natürlich viele Touristen, wir haben deutschland- oder europaweit Kunden, aber es kommen auch viele Berliner. Eine weitere große Gruppe sind russische Kunden. Zum einen dadurch, dass Russland nahe ist, den Berlinern auch mental nah ist -– nach achtzig Jahren Kommunismus war Berlin der erste sichere Hafen. Es gibt eine ganze Menge Russen die hier wohnen, die auch keine Berührungsängste vor Ost-Berlin haben. Darüber hinaus gibt es einen Trend zum Zweitwohnsitz in Berlin. Viele wohlhabende Familien aus ganz Deutschland haben heute eine Wohnung in Mitte. Die ziehen dort hin, wo Kunst, Kultur, Restaurants und interessante Geschäfte sind.
Eine ähnliche Entwicklung kennt man schon länger aus anderen Ländern – Familien in Frankreich oder England, aus Manchester oder Liverpool, New Castle, Marseille oder Bordeaux, haben eine Zweitwohnung in der Hauptstadt. Das passiert hier auch. Manche ziehen zwar nach Charlottenburg, aber im Prinzip ist West-Berlin wie Köln und Hamburg – fertig. Ein Tennisclub, Golfclub, Italiener, ein Stück KuDamm… da wird alles nur noch substituiert. Wenn zum Beispiel in Hamburg ein Restaurant aufmacht, muss ein anderes schließen, wohingegen hier im Ostteil Berlins immer etwas Neues eröffnen kann und da macht keiner zu. Es wächst sukzessive.
MR_ Ich habe gehört, dass Sie das alte Kino, das Scala in der Friedrichstrasse, nach langem Leerstand quasi zuerst wieder nutzten, weil Sie einen Raum suchten, in dem Sie ungestört laut Gitarre spielen konnten.
NJ_ Ja, ich wollte dort Schlagzeug spielen. Ich habe dann einen Club aufgemacht und den drei Jahre geführt, immer mit einem jeweiligen Manager. Das letzte Jahr war das der Connie, Connie Opper.
MR_ Vom Rio.
NJ_ Genau, das Rio machte gerade zu. Ja, das Scala habe ich gegründet, die Firma gehört mir auch noch – aber ich löse sie jetzt auf.
MR_ Machen Sie noch Musik?
NJ_ Ich spiele selber selber ein bisschen, ja. Ich lege auf, spiele Gitarre und spiele Klavier, aber nicht mehr so viel. Es ist weniger geworden leider, durch die Arbeit, aber ich spiele noch mit großer Freude. Und ich höre unglaublich viel. Ich lebe sehr mit Musik. Wenn ich aufstehe, mache ich als erstes Musik an.
MR_ Sie haben in London studiert, wie ist das, von London nach Berlin zu ziehen?
NJ_ Sehr angenehm. London ist eine ganz andere Art Stadt. Da ist viel mehr… da ist mehr Druck. Viele Ausländer bringen ihr Geld nach London, wegen der Steuervorteile. Man kann fast sagen, wer seine Firma verkauft, weltweit, zieht nach London. Auch die über fünfhundert Jahre Kolonialzeit merkt man London an, es leben mehr als 12 Millionen Menschen dort. Das hat unglaublich viel Kraft und Druck. Das Essen ist hervorragend, viele Dienstleistungen sind die besten in Europa… London ist eine wunderbare Stadt die ich sehr mag und auch vermisse. Allerdings ist London auch sehr teuer. Wenn man einmal aus dem Haus geht, ist man zwanzig Pfund los, selbst wenn man gar nichts macht.
Berlin gefällt mir unglaublich gut, es ist lockerer, einfacher. Man kann in Berlin vieles machen und es gibt viel Spannendes. Berlin wächst als Stadt auch neu zusammen, während alle anderen Städte sehr fertig entwickelt sind. Berlin findet sich neu. Es entwickelt sich eine neue Art von, man sagt „Berliner Republik“ – viele Deutsche sind einmal im Monat hier, gehen dann in den bekannten Restaurants essen, oder treffen sich mit Leuten, oder was auch immer. Wir hatten seit achtzig Jahren keine richtige Hauptstadt und auch keine richtige Metropole. Ein junger Lagerfeld ist abgehauen aus dem Norddeutschen nach Paris. Er ging nicht nach München oder Hamburg denn da „ging nichts.“ Das heißt, natürlich „ging da was,“ aber für eine richtig gute Person bot Paris mehr Potential.
MR_ Bis Ende der neunziger Jahre ist fast jeder, der wirklich erfolgreich sein wollte, weggegangen aus Deutschland, zumindest im Designbereich.
NJ_ Ja, Köln, Hamburg und München und Düsseldorf bieten eben auch nicht die Plattform für eine bestimmte Qualität, das muss man leider sagen.
MR_ Woran liegt das? Liegt das an der deutschen Mentalität? Liegt es auch am Neid?
NJ_ Es liegt an der Größe der Stadt. Und es liegt an der Sicherheit und an dem Wohlstand in Deutschland. Wenn Sie sich mal so einen Melting Pot wie London anschauen, wo es gar kein soziales Netz gibt, da haben Sie in jedem Supermarkt jemanden, der Ihnen die Tüten einpackt. Da lastet ein ganz anderer Druck auf den Menschen. Oder nehmen Sie New York, mit den vielen Einwanderern – oder insgesamt die USA mit den vielen Hispanics – da ist eine ganz andere Bewegung, eine andere Reibung. Natürlich sind da auch ganz andere Möglichkeiten. Das New York der 80er Jahre, als keiner den Überblick hatte, war ziemlich wild. Viele sagen, es erinnert sie an das Berlin von heute. Und so hat jede Stadt, auch einen gewissen Entwicklungsabschnitt, in dem sie sich befindet. In Berlin ist es gerade besonders spannend, weil es diese Konstellation so sonst nirgends auf der Welt gibt.
MR_ In Berlin ändert sich vieles. Ich habe den Eindruck, es wird vieles professioneller.
NJ_ Die Leute werden älter.
MR_ Ja, sie werden älter und haben auch einen anderen Anspruch. Es ist ein deutlich anderer Dreh dazugekommen, als etwa vor zehn Jahren in Berlin. Was mich lange gestört hat, an dieser Stadt – was ich auf der einen Seite sehr mochte, weil man sehr viel Raum zum Ausprobieren hatte, aber was auf der anderen Seite auch am Weiterkommen hindert, man blockiert sich ja selber – ist dieses ewige „Gebastel“. Jeder bastelt was.
NJ_ Ja, jeder ist zwischen zwei Projekten. Sie treffen jemanden, „was machst Du grade“ „wir arbeiten gerade an so einem Projekt,“ sechs Wochen später trifft man ihn, „na, wie läuft das Projekt“ „welches Projekt.“
MR_ Genau.
NJ_ Das liegt aber eben auch daran, wie viel Druck auf den Leuten lastet. In Berlin gab es das lange nicht. Aber was macht man hier? Stellen Sie sich vor, Sie sind Designstudent, Modestudent, und sind fertig hier in Berlin. Wo gehen Sie denn hin? Zu Michalsky? Wenn Sie Glück haben. Was machen Sie in Paris? Da gehen Sie zu Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, oder wohin auch immer. Das heißt, dort sind schon ganz andere Strukturen. Die Strukturen wachsen aber in Berlin auch mit der Gesellschaft und der Stadt weiter.
Wer in den neunziger Jahren kam und aufbaulustig war, irgendwas machen wollte, zum Beispiel in der Auguststrasse, Linienstrasse, Scheunenviertel, wo auch immer, zum Beispiel einen Club im Keller… Zum Beispiel Cookie. Das Cookies war umsonst, for free, easy going, ging alles. Irgendwann hat es Eintritt gekostet, dann ist es mal umgezogen, mittlerweile macht das Cookies Veranstaltungen und hat als Sidekick das Cream und Cookie fährt mit Sicherheit auch nicht mehr in die Uckermark in Ferien, sondern nach Ibiza oder nach Portugal. Was auch genau richtig ist! Diese Entwicklung gibt es mit vielen anderen Leuten auch. Die Autos sind heute Range Rover und nicht mehr der Passat… So wächst alles und dem entsprechend, wachsen auch die Ansprüche. Es gibt viele Berliner, die jetzt international arbeiten, zum Beispiel Stylisten oder Fotografen, die leben in Berlin, fahren nach Paris, gehen dort Mittagessen, bekommen den Job bezahlt nach Pariser Tarif. Wenn sie zurückkommen fangen sie an, bestimmte Standards, die sie von dort kennen, auch hier nachzufragen. Sei das Organic Food, gewisse Dienstleistungen… und das wächst dann alles Stück für Stück. In Berlin ist eine unglaubliche Aufbruchs- und Unternehmerstimmung. Vieles ist möglich.
Berlin zieht viel Potential an. Es kommen junge Franzosen, Italiener, Engländer – die wollen auch erst mal Party machen, easy living, das wofür Berlin berühmt ist - aber sie finden sich auch in Grüppchen zusammen und machen gute Sachen. Das ganze intellektuelle Potential, das rein gesogen worden ist in die Stadt, das muss erst noch sichtbar werden – und auch erfolgreich. Ich glaube, das ist genau der Prozess, der die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre interessant ist.
Im Bereich Wissenschaft ist Berlin ja bereits gut aufgestellt. Mit Adlershof bekommen wir einen guten Technologie-Standort, die Charité gehört neben Harvard mittlerweile zu den weltbesten Medizin-Standorten. Künstler sind exzellent vertreten, das Design-Dienstleistungssegment ist mit vielen Grafikern und anderen Freelancern gut vertreten. Was natürlich fehlt, ist eine industrielle Basis. Die Industrie wurde lange über den Westen subventioniert und nach der Wende konnten die Betriebe nicht mehr existieren, weil sie von Transferleistungen gelebt haben und als sie sich dann dem Markt stellen mussten, gingen sie den Bach runter. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch halb als Vorteil. Wenn man sieht, was derzeit in Thüringen passiert oder auch im Ruhrgebiet – wir müssen in Berlin nicht de-industrialisieren. Das ist in Thüringen ein richtiges Desaster. Man verwendet Steuergelder, um Opel aufrecht zu erhalten, aber die Amis haben sowieso vor, abzuhauen. Man macht sich was vor, wenn man noch zwei Jahre die Arbeitsplätze hält – danach kommt die Schließung so oder so. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten in Berlin auch noch Autowerke zu stützen, die langsam dahinsiechen, weil die Produktion sich nun einfach mal nach Asien verlagert…
Die Amerikaner sind da schon weiter. Es gibt ja drei Hauptsektoren, Agrar, Produktion, also Industrie, und Dienstleistungen. Die USA sind im Dienstleistungssektor schon sehr weit. Eine Dienstleistung kann ich nicht von woanders her bekommen. Stellen Sie sich vor, Sie bestellen sich eine Massage, die kommt nicht aus China, die kommt aus Berlin. Oder Sie lassen sich die Nägel machen, dafür fliegen Sie nicht nach Hong Kong oder lassen sich was schicken, das machen Sie vor Ort.
MR_ Dann sehen Sie die Zukunft Berlins eher auf dem Dienstleistungs- oder Handelssektor?
NJ_ Im Bereich Dienstleistung und Tourismus. Aber ich glaube, dass auch andere Branchen sich hier wieder ansiedeln werden. Es gibt ja schon erste Versuche, zum Beispiel im Bereich der Medien. Wenn man sich allein die Filmbranche anschaut – was die aus Köln und München nach Babelsberg oder nach Berlin gebracht hat, das ist schon beachtlich. Berlin hat viel Potential. Jedem gefällt’s, alles ist gut – „allet schick,“ wie man hier so sagt.
MR_ Haben Sie ein persönliches Motto, oder gibt es einen Grundsatz, nach dem Sie leben, ein Leitmotiv?
NJ_ Ja, das rheinische Glaubensbekenntnis. Das habe ich, als ich klein war, durch meinen Großvater kennen gelernt. „Tu niemand was an, was Du nicht willst, was man Dir antut, jeder Jeck is ene andere, jedem Tierchen sein Pläsierchen“ – so was in der Richtung. Das sind ein paar Grundregeln, die einfach überall funktionieren und ich glaube daran.
MR_ Ihr Großvater ist jemand, der für Sie besonders wichtig ist?
NJ_ Ja, klar, aber auch genau so wichtig ist mein Vater. Von meinem Großvater habe ich viel gelernt, was Lebensweisheiten angeht. Aber alle anderen in meiner Familie sind mir aber ebenso wichtig. Ich habe auch viel von meiner Mutter gelernt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, dort bekommt man viele solcher Grundsätze mit. „Et is wie et is“. Vielleicht wäre das sogar das Obermotto. Es kütt wie et kütt und et is noch immer jut jejangen. Und sonst versuche ich, ohne Furcht durchs Leben zu gehen. Das ist auch wichtig.
MR_ Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
NJ_ (Pause)… Das ist schwer zu sagen. Gesundheit, dass alle Leute die mir wichtig sind, gesund sind, das ist vielleicht das größte Glück. Und Sachen machen zu können, die einem Spaß machen, das ist auch Glück. Glück ist auch, wenn es allen Leuten gut geht, besonders denen, die einem wichtig sind. Glück gehört entscheidend dazu zum Leben. Man braucht Glück. Das weiß ich auf jeden Fall auch. Und sonst… Gustav Gans? (lacht) Man sollte genügsam und demütig sein. Man wird oft darauf trainiert, dass Glück nur das und das heißt – mir reicht das relativ simpel. Eigentlich reicht würde es reichen, wenn alle gesund sind und hier sind. Alles andere kommt und geht und heißt auch nicht so viel. Es kütt wies kütt und ist wie’s ist.
Dieser Beitrag wurde auch auf Sounds-Like-Me veröffentlicht.